Im Gespräch mit Eva Eichenauer vom Institut für Raumbezogene Sozialforschung
Eva Eichenauer arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS). Seit nun mehr zwei Jahren forscht sie im Rahmen des Projekts „ReGerecht – Integrative Entwicklung eines gerechten Interessensausgleichs zwischen Stadt, städtischem Umland und ländlichem Raum“ und veröffentlichte in diesem Rahmen vor Kurzem ein Policy Paper zu lokaler Wertschöpfung durch Windkraftanlagen. Im Rahmen ihrer Studien untersuchte sie im Raum Westmecklenburg die Wertschöpfung an Standortkommunen unter anderem durch das seit 2016 in Mecklenburg-Vorpommern bestehende Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz (BüGem). Im Interview mit der LEKA MV erklärt sie, warum ihre Forschungen alles andere als ein Plädoyer für das Gesetz sind, sie aber trotzdem glaubt, dass MV damit die richtige Entscheidung getroffen hat.
Frau Eichenauer, Sie haben in den vergangenen zwei Jahren zur Wertschöpfung von Windenergieanlagen in Mecklenburg-Vorpommern geforscht. Können Sie Ihr Forschungsprojekt näher beschreiben?
Die Forschung findet im Rahmen des Projektes „ReGerecht – Integrative Entwicklung eines gerechten Interessensausgleichs zwischen Stadt, städtischem Umland und ländlichem Raum“ statt, welches vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Wir sind ein größeres Forschungskonsortium, in dem es nicht nur um Windkraftanlagen oder das Beteiligungsgesetz geht, sondern generell um die Frage, wie Regionen in unterschiedlichsten Bereichen eine gerechte Last- und Nutzenverteilung aushandeln können. Wir am IRS sind zuständig für Fragen von Flächennutzungskonflikten und gerechten Interessensausgleichen in Bezug auf die Energiewende. Das Beteiligungsgesetz passt da sehr gut, da es als eine Möglichkeit konzipiert ist, wie man – im Sinne von Kompensations- oder Verteilungsgerechtigkeit – einen Nutzen in den Gemeinden lassen kann. Deshalb wollten wir zunächst einmal schauen, wie es sich mit dem Gesetz überhaupt verhält, was es für Erfahrungen gibt und was es vielleicht schon Gutes getan hat.
Und wie verhält es sich mit dem Gesetz? Bisher ist es doch noch nicht wirklich zur Anwendung gekommen.
Ich finde es sehr gut, dass es dieses Gesetz gibt und dass man diesen Weg gegangen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob man ohne den Vorstoß von Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich über Regelungen auf Bundesebene nachgedacht hätte. Das Gesetz hat ausgelotet, was möglich ist und sich für einen bestimmten Weg entschieden. Von diesen juristischen Vorarbeiten profitiert auch die aktuelle EEG-Novelle. Insofern ist das Gesetz also ein guter und wichtiger erster Schritt in Richtung einer gerechteren Umsetzung der Energiewende. Dass es in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht richtig zur Anwendung gekommen ist, liegt vor allem daran, dass das Gesetz erst für neu genehmigte Anlagen zutrifft. Also für Anlagen, die erst nach der Verabschiedung des Gesetzes im Mai 2016 in die Genehmigung gingen. Da die Genehmigungs- und Umsetzungsverfahren bekanntermaßen viele Jahre dauern, ist es der Verfahrensdauer geschuldet, dass jetzt erst eine Handvoll Anlagen tatsächlich in die Umsetzung gehen, die den Gemeinden die gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsangebote machen müssen. Auf dieses Problem gehen wir auch in unserem Policy Paper ein. Das Gesetz erweckt aktuell den Anschein, als würde es eigentlich niemandem etwas Gutes tun, weil es noch keine Positivbeispiele gibt. Das sind Anfangsschwierigkeiten, aber es ist natürlich schwer zu vermitteln, dass diese Anfangsschwierigkeiten fünf Jahre dauern.
Am Gesetz liegt es demnach also nicht?
Ob es auch am Gesetz liegt, kann man noch nicht so richtig sagen, solange es noch nicht wirklich ausgerollt ist. Was sich aber schon abzeichnet, ist, dass das Gesetz bestimmte Aspekte in sich trägt, die eine lokale Wertschöpfung erschweren können. Ein großes Problem, welches wir identifiziert haben, sind die Handlungsmöglichkeiten der Kommunen. Das Gesetz, so wie es sich im Moment darstellt, verpflichtet die Vorhabenträger der Gemeinde ein Beteiligungsangebot über 20 Prozent zu machen. Zudem hat die Betreiberfirma die Möglichkeit, eine Abgabe anzubieten. Die Krux hierbei ist aber, dass die Gemeinde nicht selbst entscheiden kann, ob sie sich finanziell beteiligen will oder lieber die Abgabe nimmt. Denn die Betreiberfirma ist nicht verpflichtet, diese Abgabe anzubieten. Der Akteur, der am Zug ist, ist hier aber der Vorhabenträger. Und wenn der entscheidet, dass er es nicht anbieten möchte, kann die Gemeinde nur entscheiden, ob sie das Angebot einer finanziellen Beteiligung annimmt oder nicht. Im letzten Fall ginge sie leer aus.
Was haben Ihre bisherigen Forschungen sonst noch hervorgebracht?
Zum einen hat unsere Forschung hervorgebracht, dass es weitgehend einen Konsens darüber gibt, dass es eine einheitliche, verbindliche Reglung zur lokalen Wertschöpfung braucht. Wir haben mit der Politik auf unterschiedlichen Ebenen gesprochen, auch mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, mit Menschen, die der Windkraft sehr kritisch gegenüberstehen und mit Akteuren aus der Windenergiebranche. Die einhellige Meinung war: Ja wir brauchen eine verlässliche, einheitliche Regelung, damit Wertschöpfung vor Ort geschaffen werden kann! Zum anderen stellt sich die Frage, wie so etwas dann ausgestaltet werden muss. Eine Sache, die relativ häufig angesprochen wird, ist, dass die Regelungen sehr komplex und schwer umzusetzen sind. Sowohl aus Projektierer-Sicht als auch aus Sicht der Gemeinden, die sich dann damit auseinandersetzen müssen. Ein Gesetz darf die Umsetzenden nicht überfordern. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Schaffung von Gestaltungsspielräumen. Das heißt: Zwar braucht es einerseits flächendeckende, einheitliche Mindeststandards, gleichzeitig muss aber auch Raum gelassen werden, um individuelle Lösungen zwischen Gemeindevertretungen und Vorhabenträgern aushandeln zu können.
Nun haben Sie im Rahmen Ihrer Forschung mit vielen Menschen aus MV gesprochen. Wie, ist Ihr Eindruck, stehen die Menschen zur Energiewende?
Das kommt immer darauf an, mit wem man spricht. Der Eindruck, den ich gewinne, ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass ich mich mit der Beschäftigung um den Ausbau der Windkraft in ein sehr konfliktbehaftetes Feld begebe. Ein Problem mit der Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern sehe ich darin, dass bei Vielen ein Gefühl entsteht, man selbst hätte nichts davon. Es ist ein großes Land. Es hat viel Fläche, ist sehr windhöffig. Da stehen also viele Anlagen. Aber die Wertschöpfung ist leider sehr gering. Und wenn man mit den Leuten spricht, dann sind die ziemlich enttäuscht. Sie sagen: „Nun ja, jetzt haben wir hier die ganzen Anlagen und es profitieren immer nur die anderen davon!“ Außerdem fühlt man sich ein bisschen hilflos, übergangen. Viele Gemeinden haben überhaupt keine oder wenig Flächen und haben entsprechend wenig Mitspracherecht darüber, was in ihrer nahen Umgebung passiert. Da kommt schon mal das Gefühl hoch, man würde ausgenutzt und sei ein Spielball größerer politischer oder privatwirtschaftlicher Entscheidungen auf die man keinen Einfluss hat – obwohl man direkt betroffen ist.
Der Bundeswirtschaftsminister wollte im neuen EEG 2021 eine gesetzliche Verpflichtung der Anlagenbetreiberfirmen, Kommunen finanziell zu beteiligen. Derzeit sieht es aber so aus, als dass es lediglich eine freiwillige Regelung geben wird. Wie sehen Sie diese Entwicklungen?
Wenn es tatsächlich so bleibt, sehe ich das als sehr falsches Signal. Der Sinn dahinter ist doch, dass Kommunen von der Wertschöpfung durch Windkraftanlagen profitieren. Das also irgendwas von der Wertschöpfung auch in den betroffenen Gemeinden ankommt. Dazu braucht es eine verpflichtende Regelung. Denn die freiwillige Option gab es ja immer. Vorhabenträgern war es freigestellt, mit Gemeinden gemeinsam zu überlegen, was sie umsetzen können und wie man Gemeinden in irgendeiner Form beteiligen kann. Das hat dann zu der aktuellen Situation geführt – de facto ist es kaum passiert. Dazu kommt, dass freiwillige Sonderzahlungen von Betreibern an Gemeinden durchaus auch kritisch gesehen werden können. Gerade wenn es eine Gemeinde ist, in der bereits ein Konflikt um Windkraft am Laufen ist und dann Vorhabenträger anbieten, sie könnten bestimmte Zahlungen leisten, wird es häufig so gesehen, als würde man sich Zustimmung erkaufen wollen. Wenn es aber ein Gesetz gibt, ist klar, jede Betreiberfirma muss zahlen, jede betroffene Kommune bekommt etwas ab – unabhängig davon, ob sie Flächen hat oder ob es einen Konflikt gibt oder nicht.
Es sollte demnach eine bundeseinheitliche Regelung geben?
Ich denke, ja. Einerseits um klare Verhältnisse zu schaffen, in Form einer Bundesregelung, die für alle gilt. Anderseits auch als bundespolitisches Zeichen. So kann die Bundesregierung signalisieren, dass ihnen lokale Wertschöpfung aus erneuerbaren Energien tatsächlich ein wichtiges Anliegen ist.
Sehen Sie Ansatzpunkte im BüGem aus Mecklenburg-Vorpommern, die man in einer bundeseinheitlichen Regelung übernehmen sollte?
Was man aus dem Gesetz in Mecklenburg-Vorpommern lernen kann, ist, ein Gesetz möglichst einfach zu halten und zugleich die Möglichkeit für individuelle Aushandlungsprozesse offen zu lassen. Diese Option ist im BüGem mit dem Weg alternative Lösungen auszuhandeln ja verankert. Was Mecklenburg-Vorpommern auch gezeigt hat ist, dass der Weg über verpflichtende Beteiligung vielleicht nicht der richtige ist. Es sollte eher darum gehen, dass man eine feste bzw. leistungsbezogene Abgabe einführt. Der Nutzen ist für die Gemeinden erwartbar und sie müssen im Prinzip erst mal nichts weiter tun. Gerade für Gemeinden mit wenig finanziellen, aber auch personellen Ressourcen ist das die bessere Lösung.
Ist eine finanzielle Beteiligung der Standortgemeinden, in welcher Form auch immer, aus Ihrer Sicht der Schlüssel für mehr Akzeptanz oder braucht es nicht viel mehr Diskussion?
Finanzielle Wertschöpfung ist wichtig, um zunächst einmal einen Ausgleich für die infrastrukturelle Last, die die Gemeinden zweifelsohne tragen, zu schaffen. Wichtig ist aber am Ende, dass man Entscheidungsmöglichkeiten aufmacht. Der Ansatz informelle Beteiligungsformate im Planungsprozess zu integrieren ist gut. Es ist wichtig und steht einer demokratischen Gesellschaft gut zu Gesicht, Betroffene zu informieren und auch einzubinden. Aber die ganzen Diskussionsveranstaltungen bringen nur etwas, wenn die Inhalte dort auch tatsächlich in den Entscheidungsprozess aufgenommen werden. Man darf hinterher nicht nur sagen: „Wir haben drüber geredet, vielen Dank für Ihre Meinung, aber wir machen es trotzdem so, wie wir uns das vorgestellt haben!“ Das löst einen riesigen Frust aus. Je nachdem in welchem Setting man ist – gerade in Gemeinden wo die Stimmung sowieso schon kritisch ist und man hinter allem Strategie oder Böswilligkeit vermutet – kann das schnell in die falsche Richtung gehen. So schwierig es nach aktueller Rechtslage ist, kommunale Mitentscheidungsmöglichkeiten in der Planung umzusetzen, so wichtig ist es, ein Mindestmaß an Entscheidung zumindest in den Bereich der Wertschöpfung zu integrieren. Deshalb sollte in irgendeiner Form institutionalisiert werden, dass eine Gemeinde mitentscheiden kann, welche Form die lokale Wertschöpfung annimmt.
Im Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz MV ist allerdings auch eine Einzelbeteiligungsmöglichkeit für Bürger*innen verankert. Es braucht diese Option also nicht?
Ich weiß nicht, ob es die unbedingt bräuchte. Es gibt Studien die zeigen, dass Gemeindebeteiligung wichtiger eingeschätzt wird als eine individuelle Beteiligungsmöglichkeit. Zudem ist so etwas immer daran gebunden, wer sich überhaupt beteiligen kann. Wer also noch das Extra an finanziellen Mitteln hat, kann davon profitieren. Wer nicht, geht leer aus. Es schafft somit eine Ungleichheit, die ich als nicht dienlich erachte. Würde es generell in die Kommune fließen, kann diese entscheiden, wo das Geld am sinnvollsten eingesetzt wird.
Was funktioniert Ihrer Meinung nach in Mecklenburg-Vorpommern in Bezug auf die Realisierung Erneuerbarer-Energien-Projekte bereits gut?
Mecklenburg-Vorpommern ist, was die Energiewende angeht, ein innovatives Bundesland. Es hat vor knapp fünf Jahren schon das Beteiligungsgesetz auf den Weg gebracht. Wissentlich, dass es so etwas vorher noch nicht gab und sie damit auch juristisches Neuland betreten. Das war ein großer und mutiger Schritt! Zudem ist es ja auch so, dass Mecklenburg-Vorpommern an sich ziemlich viel Windstrom produziert und tatsächlich damit bundesweit einen großen Beitrag zur Energiewende leistet. Auch im Bereich innovativer Technologien will das Land vorangehen. Es gibt viele innovative Projekte im Bereich Wasserstoff – zum Beispiel in Verbindung mit der Schifffahrt. Da sehe ich Mecklenburg-Vorpommern schon ziemlich weit vorn. Darüber wird natürlich auch Wertschöpfung generiert. Was jetzt noch fehlt ist, dass direkt in den Kommunen – in den Gemeindekassen sozusagen – etwas hängen bleibt von dieser Wertschöpfung.
Und wie genau kann das umgesetzt werden? Wo sehen Sie da den Handlungsbedarf?
Man könnte in einem Gesetz die Mitsprache verankern indem man sagt, die Gemeinden können wählen: Wollen sie eine Beteiligung oder lieber eine feste Abgabe. Es geht darum zu sagen, was besser zur jeweiligen Situation der Gemeinde passt. Es gibt sicher Gemeinden die sagen, ihnen gefallen die Zahlen und sie scheuen sich nicht vor dem finanziellen Risiko oder davor, einen Kredit dafür aufzunehmen. Und dann wird es Gemeinden geben, die sich über eine jährliche Abgabe freuen, die dann für die Gemeinde genutzt werden kann – beispielsweise für den Bürgersteig, den Kindergarten oder den Spielplatz. Da lassen sich sicher Spielräume einbringen. Das Ziel sollte sein, dass Vorhabenträger und Gemeinden sich an einen Tisch setzen und ausloten, was die beste Lösung für alle ist.
Und glauben Sie, es braucht zur Realisierung entsprechender Projekte Institutionen wie Klimaschutzagenturen?
Aus unserer Sicht sind Organisationen wie Landesenergieagenturen, also zum Beispiel die LEKA MV, unbedingt notwendig für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende. Diese sind die Schnittstelle, die Übersetzerinnen quasi, zwischen gesetzlichen Regelungen, Vorhabenträgern und der Kommune. Den Kommunen wird sehr viel aufgeladen und Prozesse wie auch Entscheidungen und die zugehörigen planerischen, juristischen, die technischen und auch die finanziellen Hintergründe sind ungemein komplex. Und da ist es wichtig, dass man eine Institution hat, die berät und die Kommunen auch bei Verhandlungen und Entscheidungen unterstützt. Gerade in Mecklenburg-Vorpommern, wo die meisten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ehrenamtlich tätig sind.
Wie genau sähe eine Unterstützung durch solche Institutionen aus?
Zum Beispiel, indem man Netzwerke aufbaut! Also im Prinzip das, was Sie mit Ihren letzten Veranstaltungen, der Exkursion nach Kalsow oder mit der Schulung in Wöbbelin begonnen haben: Interessierte zusammenbringen, um sich gegenseitig auszutauschen und zu unterstützen. Um darüber zu reden, was gemacht werden kann, wo es Probleme gibt, wie diese umgangen werden können. Wer sind gute Ansprechpartner*innen? Mit welchen Vorhabenträgern wurden gute Erfahrungen gemacht? Gleichzeitig ist es auch schön, wenn man das Netzwerk ausweitet. Also nicht nur Kommunen in den Blick nimmt, die sagen, sie wollen Vorreiterkommunen werden, sondern, dass man generell eine Unterstützungsstruktur anbietet. Zum Beispiel, wenn es eine Gemeinde gibt, in der ein Windpark entstehen soll und die sich fragt, was denn nun überhaupt auf sie zu kommt und was sie machen kann. Da ist es wichtig, dass es Organisationen gibt, die sagen: „Wir können euch beraten, wir können euch aber auch mal die Telefonnummer geben von zwei, drei Bürgermeistern, die auch in eurer Situation waren. Die können euch dann aus erster Hand erzählen, was auf euch zukommt.“ Für diese wichtigen Aufgaben braucht es eine Stelle, die dafür verantwortlich ist und der man da als Gemeinde vertrauen kann. Idealerweise ist das eine Landesenergieagentur.
Das Interview führte unsere ehemalige Mitarbeiterin Caroline Kohl im Jahr 2020.
Fazit
Eva Eichenauer, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung, untersucht im Rahmen des Projekts „ReGerecht“ die lokale Wertschöpfung durch Windkraftanlagen in Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere unter Berücksichtigung des Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetzes (BüGem). Während das Gesetz als wichtiger Schritt hin zu einer gerechteren Energiewende gesehen wird, identifiziert Eichenauer Herausforderungen, wie etwa die begrenzten Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden und die Notwendigkeit einer verbindlichen bundesweiten Regelung. Sie betont die Bedeutung von Mitsprachemöglichkeiten für Kommunen und die Rolle von Institutionen wie Landesenergieagenturen bei der Unterstützung dieser Prozesse.







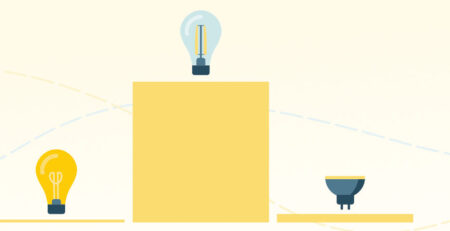

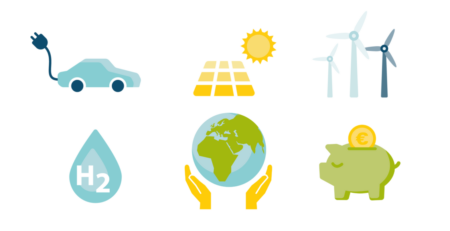
Comments (1)
Ihr Artikel behandelt in erster Linie die Beteiligung der Gemeinden. Warum gehen Sie nicht auch auf die Möglichkeit der direkten Beteiligung der Bürger ein? Schließlich ermöglicht doch das BüGem auch die Lieferung von verbilligtem Strom an die betroffenen Bürger im Umkreis von 5000m der Windkraftanlagen.
Ich denke das die Lieferung von verbilligtem Strom an die Bürger in unmittelbarer Nähe der Windkraftanlagen die beste Möglichkeit ist um die Akzeptanz der Anlagen zu erhöhen. Da die Häuser und Grundstücke in direkter Nähe zu den WEA’s sehr stark an Wert verlieren werden, sobald die WEA’s errichtet sind, sollte eine entsprechende Kompensation erfolgen. Meiner Meinung nach sollte daher die verbilligte Lieferung von Strom an die Besitzer der Anwesen in direkter Nähe gezahlt werden. Somit könnten diese den günstigen Strom für die Beschaffung eines Elektromobils oder auch für den Betrieb einer Elektroheizung für das Haus, oder Ähnlichem verwenden. Dies wäre eine gute Lösung um den Wertverlust der Anwesen zumindest zum Teil zu kompensieren.
Da in Bayern der Abstand zu den Windanlagen erheblich größer ist als in MV, (10-fache Höhe der Anlage =Abstand zur Bebauung, bei 250m Höhe der WEA sind das 2500m und in MV 1000m), sollte man die Zahlung an die Bürger in Abhängigkeit vom Abstand zwischen 1000m und 2500m nach einer linearen Funktion verteilen.
Wenn der betroffene Bürger, bzw. das betroffene Anwesen in der Nähe der WEA`s eine jährliche Gutschrift von x- kWh elektrischer Energie erhalten würde, ist das eventuell sogar ein Anreiz sein Domizil in der Nähe einer WEA zu suchen. Somit wird die gewünschte Akzeptanz einer grünen Energieerzeugung aus Windkraft bestimmt schneller erreichbar sein.
Schließlich war es ja auch die Idee von Angela Merkel, Manuela Schwesig, und weiteren Politikern die Bürger direkt zu beteiligen.
Comments are closed.